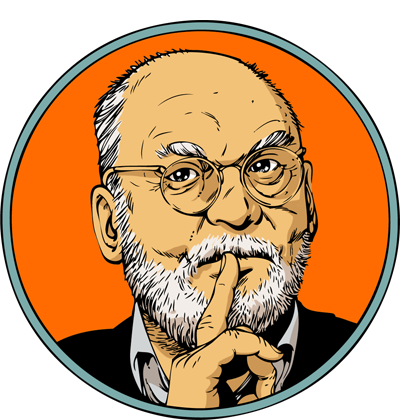© epd-bild/Jürgen Blume
Der Bundestag wird diese Woche darüber entscheiden, ob die Hilfe beim Suizid durch ein Gesetz reguliert werden soll.
Drei Jahre ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht ein Grundsatzurteil zur Sterbehilfe in Deutschland verkündete. Der zentrale Satz lautete: "Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen." Erst 2015 hatte der Bundestag ein Verbot sogenannter geschäftsmäßiger Hilfe bei der Selbsttötung verabschiedet, das auf Sterbehilfeorganisationen zielte. Dieses Verbot wurde in Karlsruhe gekippt. Suizidassistenz konnte wieder organisiert, sogar als Geschäftsmodell stattfinden.
Es dauerte nach dem Urteil einige Zeit, bis sich erneut Parlamentarier an eine Regelung machten. Ihr Ziel ist im Wesentlichen, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts rechtliche Klarheit für Sterbehelfer zu schaffen und zugleich dafür zu sorgen, dass Missbrauch ausgeschlossen wird. Gesucht wird eine Regelung, die sowohl dem Anspruch auf selbstbestimmtes Sterben als auch dem Lebensschutz genügt. Seit Anfang 2022 liegen dafür Vorschläge vor, die den Akzent dabei unterschiedlich setzen. Am Donnerstag soll der Bundestag über die Entwürfe abstimmen.
Eine Gruppe um Lars Castellucci (SPD), Ansgar Heveling (CSU) und weiteren Initiatoren von Grünen, FDP und Linken hat einen Entwurf vorgelegt, der die geschäftsmäßige Suizidassistenz wieder unter Strafe stellen und nur unter Voraussetzungen ermöglichen würde. Zu den Bedingungen zählen eine psychiatrische oder psychotherapeutische Begutachtung sowie eine Beratung. Man wolle den assistierten Suizid "ermöglichen und nicht fördern", sagte Castellucci dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Wir wollen in die Suizidprävention investieren, nicht in flächendeckende Suizidberatung", ergänzte er.
Dieser Vorwurf zielt auf den Konkurrenzentwurf. Die Gruppen um die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr und die Grünen-Politikerin Renate Künast (Grüne) hatten ihre ursprünglich verschiedenen Entwürfe erst kürzlich zusammengelegt und wollen damit die Stimmen für ein liberales Gesetz auf einen Vorschlag versammeln. Ihr Plan sieht eine Regelung ähnlich der des Schwangerschaftsbruchs vor, allerdings außerhalb des Strafgesetzes. Suizidassistenz wäre nach einer Beratung möglich. In medizinischen Härtefällen soll ein Arzt auch ohne Beratung tödlich wirkende Mittel verschreiben dürfen. In der Grundhaltung gehe es um den Respekt vor dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben, sagte Helling-Plahr.
Wie die Abstimmung ausgeht, ist völlig offen. Beide Entwürfe werden von Abgeordneten aus mehreren Fraktionen unterstützt, abgestimmt wird nicht entlang von Parteigrenzen. Die Gruppe um Helling-Plahr hat rund 150 Unterstützer und Unterstützerinnen, die von Castellucci rund 130, wie aus den Büros zu erfahren war. Eine Mehrheit der 736 Mitglieder des Parlaments ist offenbar noch unentschieden.
Angenommen wäre am Donnerstag ein Entwurf, wenn er die einfache Mehrheit, also mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält. Damit ist auch möglich, dass beide Entwürfe durchfallen. Passiert ist das in dieser Wahlperiode bereits einmal bei der Gewissensabstimmung über die Impfpflicht.
Diakoniepräsident warnt vor Normalisierung
Außerhalb des Parlaments gibt es nicht wenige, die das nicht unbedingt bedauern würden. Die Kritik aus Fach- und Sozialverbänden ist groß. Die Liste derer, die sich mit keinem der beiden Entwürfe anfreunden konnten, wurde zuletzt immer länger. Zu ihnen gehören das Nationale Suizidpräventionsprogramm und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Der frühere Ethikratsvorsitzende Peter Dabrock veröffentlichte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einen Gastbeitrag mit einem Appell, auf das Gesetz zu verzichten.
Diakonie-Präsident Ulrich Lilie warnte, der Aufbau eines Beratungs- und Begutachtungssystems hätte den paradoxen Effekt, dass Normalisierung eintrete. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) konnte sich zu keiner konkreten Empfehlung durchringen, die sie beim Gesetz 2015 noch abgab. Wie andere auch fordern sie vor dem Suizidassistenz-Gesetz ein Suizidpräventionsgesetz.
Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt, dessen Berufsstand in beiden Vorschlägen eine zentrale Rolle spielen soll, äußerte sich zuletzt richtiggehend verärgert über die Aufsetzung der Abstimmung noch vor der Sommerpause. Über die erst kürzlich erfolgten Änderungen an den Entwürfen sei nicht ausreichend debattiert worden, sagte er und forderte, die Entscheidung noch einmal zu vertagen. Die Debatte hat diesmal in seinen Augen "nicht den ausreichenden Grad von Ernsthaftigkeit".
Abstimmung über Sterbehilfe: Das sind die Vorschläge
Am Donnerstag stimmt der Bundestag darüber ab, ob und wie die Hilfe bei der Selbsttötung gesetzlichen Regularien unterworfen wird. Seit das Bundesverfassungsgericht vor drei Jahren das Verbot sogenannter geschäftsmäßiger Suizidassistenz gekippt hat, ist diese Art der Sterbehilfe grundsätzlich wieder möglich, bleibt durch Bestimmungen im Betäubungsmittelgesetz aber in einem rechtlichen Graubereich.
Im Bundestag gibt es zwei Regelungsvorschläge. Gemeinsam haben sie, dass sie im Betäubungsmittelgesetz die Abgabe tödlich wirkender Mittel auch für den Zweck der Selbsttötung erlauben, gleichzeitig aber Ärzte nicht zu dieser Form der Sterbehilfe verpflichten wollen. Beide unterscheiden sich jedoch bei dem vorgesehenen Verfahren. Das sind die Vorschläge:
*VERBOT MIT AUSNAHMEN: Eine Gruppe um die Abgeordneten Lars Castellucci (SPD), Ansgar Heveling (CDU) und weiteren Abgeordneten von Grünen, FDP und Linken will die Hilfe bei der Selbsttötung in organisierter ("geschäftsmäßiger") Form erneut unter Strafe stellen, unter bestimmten Voraussetzungen aber erlauben. Dazu zählt, dass die Sterbewilligen sich zweimal mit einem Mindestabstand von drei Monaten einer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Begutachtung unterziehen, ein zusätzliches Beratungsgespräch in Anspruch nehmen und nach der Begutachtung mindestens zwei Wochen, höchstens aber zwei Monate bis zur Selbsttötung vergehen.
Die ärztliche Begutachtung soll ausschließen, dass "keine die autonome Entscheidungsfindung beeinträchtigende psychische Erkrankung vorliegt". Der oder die Sterbewillige muss zudem volljährig sein. Verstöße gegen dieses Verfahren sollen mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Das gegenüber dem anderen Vorschlag strengere Verfahren soll dazu dienen, die Autonomie Suizidwilliger zu schützen. Nach Auffassung der Gruppe werden Betroffene, auf die durch bestehende Suizidhilfe-Angebote Druck entstehen könnte, so am besten geschützt.
*ERMÖGLICHUNG UNTER BEDINGUNGEN: Eine Gruppe um Katrin Helling-Plahr (FDP), Renate Künast (Grüne) und weiteren Parlamentariern von SPD und Linken betont gegenüber dem anderen Vorschlag mehr das Recht, Hilfe bei der Selbsttötung in Anspruch zu nehmen und will ein Beratungsverfahren ähnlich wie beim Schwangerschaftsabbruch etablieren, um Suizidassistenz zu ermöglichen. Der Entwurf sieht den Aufbau eines Beratungsnetzes vor. Beratungsstellen sollen den Sterbewilligen eine Bescheinigung ausstellen, auf deren Grundlage ein Arzt oder eine Ärztin nach frühstens drei, spätestens zwölf Wochen nach der Beratung ein tödlich wirkendes Medikament verschreiben dürfte. Auch sie machen Volljährigkeit des oder der Betroffenen zur Voraussetzung.
In Härtefällen, im Entwurf etwa beschrieben als "existentieller Leidenszustand" infolge einer unheilbaren und fortgeschrittenen Krankheit, dürfte ein Arzt das Mittel auch ohne vorherige Beratung verschreiben. Zudem sollen die Länder Stellen benennen, die alternativ zu einem Arzt oder einer Ärztin die Verschreibung übernehmen sollen, wenn das andere Verfahren für die betroffene Person nicht zumutbar ist. Dies gilt etwa für den Fall, dass die oder der Sterbewillige keinen Arzt findet, der zur Verschreibung der Mittel bereit ist.