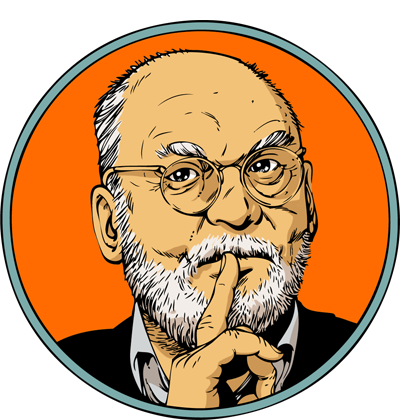Foto: Martin Rothe
Bevor der heutige US-Präsident Barack Obama in die Politik ging, arbeitete er Mitte der 80er Jahre in den Armenvierteln Chicagos. Was er dort leistete, war nicht klassische Sozialarbeit, sondern "Community Organizing" nach dem Vorbild des radikalen Demokraten Saul Alinsky (1909-1972): Der 25-jährige Obama ging von Haus zu Haus und schmiedete eine Allianz von Bürgern, die die Lebensqualität ihres Viertels dauerhaft verbessern wollten.
"Community Organizing" ("Organisieren der Gemeinschaft") nennt sich das Konzept, das es seit 20 Jahren auch in Deutschland gibt. 1993 fand im hessischen Gelnhausen das erste Training statt. Alinskys Idee zündete auch in deutschen Köpfen: Die Menschen vor Ort können selbst etwas verändern - unabhängig von Parteien, Ideologien oder staatlichen Geldern. Und zwar nicht nur, wie Bürgerinitiativen es tun, bei einem einzelnen Projekt, sondern in Gestalt einer langfristigen Bürgerplattform, die sich jedem Thema zuwenden kann, das den Anwohnern auf den Nägeln brennt. Das notwendige Geld kommt etwa von Stiftungen und Spenden der Mitglieder.
Von Schlüsselpersonen und Organizern
Das Konzept des "Organizing" kennt zwei Arten von Akteuren: die Schlüsselpersonen und den Organizer. Die Schlüsselpersonen sind zumeist Vertreter von Kirchengemeinden, Sozialverbänden oder andere Multiplikatoren wie Lehrer, Pflegedienstleiterinnen oder Ladenbesitzer. Sie, die Ehrenamtlichen, "sind" die Bürgerplattform: Gemeinsam entscheiden sie über die Aktionen, recherchieren die Sachlage und machen Druck auf Politiker.
Der Vater von zwei Kleinkindern ist seit vier Jahren dabei - erst als Elternvertreter vonseiten der örtlichen Kita und seit Januar 2013 als Organizer. Er ist immer noch beeindruckt, dass Community Organizing funktioniert: "Dass Menschen es ohne äußeren Zwang schaffen, verbindliche langfristige Strukturen aufzubauen und etwas zu erkämpfen, ist eigentlich ein Wunder." Den Grund dafür sieht Richter in den persönlichen Beziehungen zwischen den Schlüsselpersonen: "Die Leute kennen sich - das macht was aus!"
Ehemals DDR-Industriestandort - heute Studentenkiez
Die Stadtteile Nieder- und Oberschöneweide liegen im Südosten der Hauptstadt und waren zur DDR-Zeit ein wichtiger Industriestandort. Nach 1990 brachen hier Tausende Arbeitsplätze weg. Die Wende für die Stadtteile bahnte sich an, als vor zwölf Jahren die Bürgerplattform "Organizing Schöneweide" aufgebaut wurde. Nach drei Jahren harter Arbeit gelang ihr ein erster großer Erfolg: In eine der Industriebrachen zog die Hochschule für Technik und Wirtschaft ein. Seither tummeln sich im Kiez viele Studenten. "Das war der entscheidende Punkt. Seitdem zieht es hier an", sagt Andreas Richter.
Die nächste Errungenschaft war der Neubau einer Fußgängerbrücke über die Spree. Und aktuell kämpfen Aktionsteams der Plattform für mehr Arbeitsplätze und mehr Fachärzte im Viertel sowie für eine Umgehungsstraße und einen besseren Zugang zum Spreeufer.
"Wir lassen uns nicht einlullen"
Inzwischen haben sich den verbündeten Bürgern viele Türen aufgetan - in den örtlichen Unternehmen und in der Berliner Lokal- und Landespolitik. Bei ihren Begegnungen mit Mitgliedern des Berliner Senats versuchen die Bürgervertreter bewusst, Augenhöhe herzustellen. "Wir lassen uns nicht einlullen", sagt Andreas Richter. "Zu unseren Regeln gehört, dass wir uns an die vereinbarte Redezeit halten, die eingeladenen Politiker aber auch". Dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit musste schon einmal das Mikrofon abgestellt werden.
Es gehöre zu den Prinzipien von Community Organizing, Konfrontationen mit der Politik oder mit Konzernen nicht aus dem Wege zu gehen. "Die Macht wird euch niemals gegeben, ihr müsst sie euch nehmen", lautet eine Parole des Begründers Saul Alinsky. "Unsere Leute mussten sich erst daran gewöhnen, für ihre Rechte einzutreten", sagt der Organizer aus dem Berliner Osten. "Wo gibt es das sonst, dass Menschen, die sich das nie vorgestellt hätten, auf einmal Verhandlungen mit Senatoren bestreiten oder eine Versammlung von 500 Leuten leiten?"