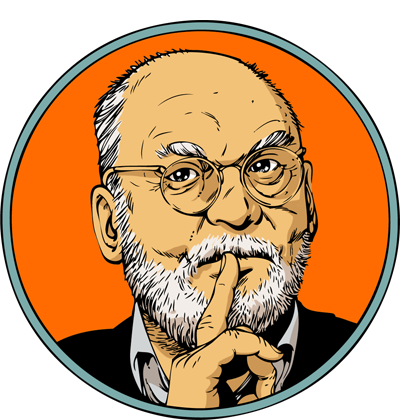© epd-bild/Rolf Zoellner
Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung Felix Klein und der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster betonten, Antisemitismus sei immer auch demokratiefeindlich, in allen seinen Formen.
In Deutschland haben antisemitische Straftaten dramatisch zugenommen. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte am Donnerstag in Berlin, seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober habe das Bundeskriminalamt bis zum 22. Januar dieses Jahres 2.249 antisemitische Straftaten erfasst. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr wurden Klein zufolge rund 2.300 antisemitische Straftaten registriert.
Der Terrorangriff der Hamas habe auch auf deutschen Straßen eine Welle von Judenhass ausgelöst. Und die Angriffe gingen weiter. "Dennoch erregt die Situation der Jüdinnen und Juden weit weniger Mitgefühl und Solidarität in der Gesellschaft, als ich es für notwendig halte", sagte Klein: "Das beschämend hohe Niveau judenfeindlicher Taten hat sich normalisiert, so sehr, dass es aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist." Dabei gebe es für Jüdinnen und Juden seit dem 7. Oktober keine Normalität mehr.
Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sprach von einer großen Belastung für die Betroffenen. Die meisten der gemeldeten Fälle passierten im öffentlichen Raum und reichten von verletzendem Verhalten über Angriffe und Bedrohungen bis hin zu extremer Gewalt. Jüdinnen und Juden reagierten mit Vorsichtsmaßnahmen und Rückzug, Kulturveranstaltungen würden abgesagt, der Gottesdienstbesuch habe abgenommen. "Die Folge: Jüdisches Leben ist weniger sichtbar geworden", sagte Schuster. Auch im privaten Leben nähmen antisemitische Erfahrungen zu.
Der Zentralrat habe als Reaktion eine Video-Reihe gestartet, erklärte Schuster. In der Kampagne "Stop repeating stories", die Aufmerksamkeit und Mitgefühl wecken soll, kommen nach Angaben des Zentralrats Menschen zu Wort, die von den Vorkommnissen berichteten. Eine künstliche Intelligenz habe sie in den Videos altern lassen, sodass sie wie Zeitzeugen aus den 1930er Jahren wirkten. Im Verlauf der Videos erschienen sie zunehmend jünger. Dadurch werde klar, dass sie nicht von lange Vergangenem erzählten, sondern von aktuellen Ereignissen. Schuster sagte, die Geschichte wiederhole sich nicht, aber die Geschichten erinnerten daran.
Klein und Schuster betonten, Antisemitismus sei immer auch demokratiefeindlich, in allen seinen Formen. Beide begrüßten die Demonstrationen gegen den zunehmenden Rechtsextremismus. Schuster sagte, offenbar seien durch die Enthüllungen über die Nähe zwischen der AfD und Rechtsradikalen viele Menschen aufgewacht und sähen die Gefahren für die Demokratie. Klein erneuerte seine Forderung nach einer Verschärfung des Paragrafen gegen Volksverhetzung, damit Antisemitismus auch mit strafrechtlichen Mittel besser bekämpft werden könne.
Die jüngste Eskalation des Nahost-Konflikts, die auf der ganzen Welt und auch in Deutschland zu antisemitischen Reaktionen führte, begann am 7. Oktober mit einem massiven Terrorüberfall der palästinensischen Hamas auf Israel. Die israelische Armee bombardierte daraufhin den Gaza-Streifen und drang in das Gebiet ein, um die Hamas zu zerschlagen. Seitdem dauert der Krieg im Gaza-Streifen an.