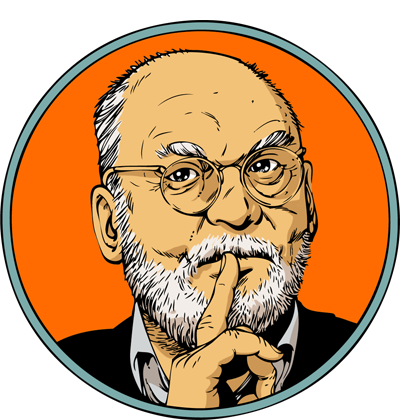© epd/Timm Schamberger
Gekleidet im Talar gehen in Neuendettelsau Studierende der evangelischen Theologie über den Campus der Augustana-Hochschule. Die Berufschancen für angehende Pfarrer:innen waren noch nie so gut wie heute. (Archivbild)
Ein Drittel. So viele Pfarrstellen waren noch vor vier Jahren im evangelischen Kirchenkreis Peine unbesetzt. Mittlerweile liege die Vakanzquote im Kirchenkreis Peine bei unter zehn Prozent, erklärt Superintendent Volker Menke. Die hohe Zahl an unbesetzten Stellen habe man einerseits mit Probedienstlern besetzen können. "Das ist natürlich eine prekäre Situation", sagt Menke, sein Kirchenkreis bemühe sich, diese Leute nach Ende ihrer dreijährigen Probezeit zu halten.
Andererseits sei die Vakanzquote aber auch dadurch gesunken, dass man Pfarrstellen abgebaut habe. Da die Zahl der Kirchenmitglieder ständig weniger werde, sei das Verhältnis von Pastorinnen und Pastoren zu Mitgliedern aber etwa gleich geblieben.
Auch andernorts haben evangelische Gemeinden Mühe, Pfarrstellen zu besetzen. Der Fachkräftemangel ist mittlerweile auch hier angekommen. 30 Prozent unbesetzte Pfarrstellen seien schon ein Ausreißer nach oben, ordnet Andreas Kahnt ein, Vorsitzender des Verbands evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland. Tendenziell gebe es mehr Vakanzen auf dem Land als in Städten, obwohl das je nach Landeskirche unterschiedlich sei.
Unterschiedlich sind nach Kahnts Worten auch die Belastungen, die eine Vakanz für die benachbarten Pfarrstellen mit sich bringt. Natürlich müssen die anderen Pfarreien die Aufgaben übernehmen: Gottesdienste, Seelsorge, Beerdigungen. Müsse die Vertretung beispielsweise auch zehn Stunden Schulunterricht pro Woche übernehmen, sei so eine Vakanz "schon eine Herausforderung", sagt Kahnt.
Veraltetes Berufsbild?
Die katholische Kirche als Weltkirche kann Vakanzen entgegenwirken, indem sie Priester aus anderen Ländern hierzulande einsetzt. Zwar ist auch das kein Allheilmittel gegen den theologischen Fachkräftemangel, weil der in anderen Ländern genauso herrscht. Den kleinteiligen evangelischen Kirchen steht dieses Mittel nicht zur Verfügung. Andere Strategien sind gefragt.
Vor allem müssten die Kirchen das Berufsbild zeitgemäß gestalten, sagt Kahnt, mit Vertretungsregelungen und verlässlicher Freizeit. Denn heute wolle kaum noch jemand eine Arbeit haben, in der er rund um die Uhr erreichbar sein müsse.
Interesse zeigen und Unterstützung anbieten
Das Dekanat Bergstraße in Südhessen geht den Weg der Nachwuchsgewinnung und -pflege. "Entscheidend ist, ein positives Bild der Landeskirche als Arbeitgeber zu vermitteln", erklärt Dekan Arno Kreh. Sein Dekanat unterstützt Theologiestudierende mit 50 Euro Büchergeld pro Semester und mit der Vermittlung von Praktikumsplätzen, zum Beispiel in Kirchengemeinden, Krankenhäusern oder Gefängnissen.
Und Kreh hält persönlich Kontakt: Ein Mal im Jahr lädt er seine Theologiestudierenden ein und spricht mit ihnen. "Das ist ein Signal des Dekanats, dass es sich dafür interessiert, wie es bei ihnen läuft", erläutert er. Auch nach dem Studium hält Kreh Kontakt zum Nachwuchs. Er lade Vikarinnen und Vikare - also Pfarrpersonen in der Ausbildung - zu Gesprächen ein, sagt er.
Das Dekanat Biedenkopf-Gladenbach liegt im ländlichen Mittelhessen, ein kleines Zipfelchen Nordrhein-Westfalen gehört auch dazu. Trotz seiner ländlichen Struktur sind hier aktuell alle Pfarrstellen besetzt. Vor zwei Jahren habe es im Dekanat noch viele Vakanzen gegeben, berichtet Dekan Andreas Friedrich. Dass das gerade anders ist, liege wahrscheinlich unter anderem daran, dass das Dekanat bei der Strukturreform schon viel von seinen Hausaufgaben erledigt habe.
Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau baut nämlich gerade die Struktur ihrer Gemeinden um. Einzelne Kirchengemeinden schließen sich zu Nachbarschaftsräumen zusammen, in denen mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer zusammenarbeiten, außerdem kirchenmusikalisches und gemeindepädagogisches Personal. Ähnliche Reformprozesse laufen in anderen Landeskirchen.
Im Zuge dieser Prozesse entfallen Pfarrstellen. Aber das sei nicht allein der Grund, warum sein Dekanat derzeit gut dastehe, sagt Friedrich. Rückmeldungen, sagt er, legten nahe, dass es Pfarrerinnen und Pfarrer schätzten, wenn sie sich auf die Gemeindearbeit konzentrieren könnten. "Da haben wir einen Vorsprung vor anderen Dekanaten", erklärt er.
Das werde nicht so bleiben, da habe er keine Illusionen, sagt der Dekan. Auf lange Sicht müsse man sich bei der Gewinnung von Nachwuchs mehr strecken. Junge Leute könnten etwa durch Praktika, Ehrenamt oder ein Freiwilliges Soziales Jahr in die Gemeindearbeit hineinschnuppern und so den Weg in ein Theologiestudium und ins Pfarramt finden, hofft er.
Weniger Theologiestudierende an deutschen Unis
An deutschen Universitäten studieren weniger Menschen Theologie als noch vor fünf Jahren. Die Gründe für diesen Rückgang seien sehr verschieden, sagte Gerald Kretzschmar, Studiendekan der Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Im gesamten Bereich der Geisteswissenschaften gebe es einen Rückgang der Studierendenzahlen. Vergleiche man die Entwicklung der Erstsemesterzahlen mit denen der Konfirmationen, sehe man laut Kretzschmar eine Korrelation. Der Rückgang der Kirchenbindung führe auch zu einem Rückgang der Zahl von Menschen, die sich für ein Theologiestudium interessierten.
Im Verhältnis zur Ablehnung gegenüber der Kirche in der Gesellschaft könne man allerdings froh sein, dass die Studierenden überhaupt noch kommen, sagt der Studiendekan. Das Theologiestudium stärker von den Kirchen zu entkoppeln, könne eine Strategie sein, um wieder mehr Studierende zu bekommen, ergänzte der Professor. Das Interesse am Thema Religion sei eigentlich hoch.
In Tübingen habe man deswegen neue Studiengänge einführt, sagt Kretzschmar. Ein Beispiel sei der Studiengang "Interfaith Studies", in dem die breite in Tübingen vorhandene Expertise in evangelischer und katholischer Theologie, sowie in Judaistik und islamischer Theologie gebündelt würde.
Ein anderer neuer Studiengang sei "Christentum in Kultur und Gesellschaft", sagte Kretzschmar. Dieser werde sogar als Bachelor und als Master angeboten. Die Kirchen könnten laut dem Studiendekan auch von diesen neuen Studiengängen profitieren. Dafür müssten sie diese neben der klassischen Theologie als Voraussetzung für den Pfarrdienst anerkennen. Das könne ein Mittel gegen die Nachwuchsprobleme im Pfarramt sein.