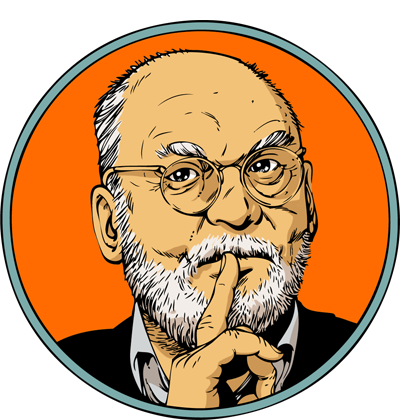© epd-bild/Zeitenspiegel/Frank Schulze
Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 in Schuld in Rheinland-Pfalz. Die Theologin Kurschus forderte ein Jahr nach der Flut, die Hilfsbereitschaft von Organisationen und Privatpersonen dürfe nicht abreißen.
Auch ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe sei vielerorts noch keine Normalität zurückgekehrt, erklärte die westfälische Präses am Dienstag in Bielefeld. Es seien weiterhin Anstrengungen nötig, um "die Folgen der Flut zu beseitigen und den Menschen im Ahrtal und anderswo zur Seite zu stehen, damit sie ihr Leben lebenswert gestalten können", sagte die leitende Theologin.
Gefordert seien sowohl Politik und Verwaltung, erklärte Kurschus. Auch die Hilfsbereitschaft von Organisationen und Privatpersonen dürfe nicht abreißen. Die leitende Theologin würdigte die "riesige Hilfsbereitschaft". Allein über die Diakonie Katastrophenhilfe seien mehr als 43 Millionen Euro gespendet worden. Nach wie vor seien Helfer:innen der Diakonie vor Ort im Einsatz. Das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe habe langfristige Hilfe zugesagt. Auch die Kirchen in den betroffenen Regionen blieben aktiv, durch Seelsorge vor Ort, Beratung und finanzielle Unterstützung sowie mit Gebeten.
"Ein Jahr nach der furchtbaren Flut ist es Zeit, dem Gedenken an die Katastrophe, an die Menschen, die von ihr unmittelbar betroffen waren, erneut Gehör zu verschaffen, es einmal wieder öffentlich kundzutun", erklärte Kurschus. Ihrer habe man seitdem immer gedacht, "mit ihnen gehofft, für sie gebetet". Noch immer kämpften die Menschen um die Rückkehr in einen geregelten Alltag, erklärte Kurschus weiter. Nach wie vor seien die betroffenen Regionen schwer von den Zerstörungen gezeichnet.
Um den 14. Juli 2021 entstanden in vielen Städten und Gemeinden auf dem Gebiet in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz durch das Hochwasser und die Schlammfluten schwere Schäden. Mehr als 180 Menschen starben in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.
Zum Gedenken finden mehrere Veranstaltungen in der Region statt: Am Donnerstagabend gibt es in Euskirchen einen ökumenischen Gedenkgottesdienst mit Bundespräsident Steinmeier und NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU). Zeitgleich gibt es eine Gedenkfeier im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Am Freitag ist ein ökumenischer Gottesdienst mit dem rheinischen Präses Thorsten Latzel und dem Trierer Bischof Stephan Ackermann in Ahrbrück geplant.
Stichwort: Hochwasserkatastrophe 2021
Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 kamen in Deutschland mehr als 180 Menschen ums Leben: 135 in Rheinland-Pfalz und 49 in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 800 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Ganze Orte wurden zerstört, Häuser, Betriebe, Infrastruktur und öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser und Kultureinrichtungen beschädigt.
In NRW sind über 180 Kommunen mit rund 20.000 Privathaushalten und 7.000 Unternehmen betroffen, besonders die Orte Hagen, Erftstadt und Euskirchen. Rheinland-Pfalz zählt 65.000 privat Betroffene und 3.000 Unternehmen. Vor allem im Ahrtal richtete die Flut schwere Verwüstungen an: Etwa 17.000 Menschen verloren ihren gesamten Besitz. Auch in der Eifel wurden Orte wie Schleiden und Bad Münstereifel von den Wassermassen zerstört.
Laut des Rückversicherers Münchener Rück verursachte das Unwetter Schäden in Höhe von 46 Milliarden Euro, davon allein 33 Milliarden Euro in Deutschland. Damit ist die Flut die teuerste Naturkatastrophe, die je in Deutschland und Europa verzeichnet wurde.
Für den Wiederaufbau stellen Bund und Länder gemeinsam bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Anträge können seit September 2021 gestellt werden. Privatleute bekommen Unterstützung in Höhe von bis zu 80 Prozent der Wiederaufbaukosten. Allerdings gibt es Kritik an dem komplizierten Verfahren, das nur online zugänglich ist, und an den anfangs langen Bewilligungszeiten.
In NRW wurden bis zum 1. Juli 1,6 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfen bewilligt. In Rheinland-Pfalz lag der Betrag bei bislang 540 Millionen Euro. Hilfsorganisationen zufolge wird der Wiederaufbau noch einige Jahre dauern. Das liegt unter anderem am Personal- und Materialmangel in den betroffenen Gebieten. Auch eine psychosoziale Betreuung ist weiterhin nötig.
Die Katastrophe rief in Deutschland eine große Hilfs- und Spendenbereitschaft hervor: So verzeichnete etwa das Hilfsorganisationen-Bündnis "Aktion Deutschland hilft" die Rekordsumme von 282,2 Millionen Euro, bei der Diakonie Katastrophenhilfe RWL gingen 43,3 Millionen Euro ein. Tausende Menschen halfen in den betroffenen Regionen bei den Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten.
Auslöser für stundenlangen Starkregen und Sturzfluten und die dadurch überquellenden Flüsse, Nebenarme und Bachläufe war das Tiefdruckgebiet Bernd, das tagelang über Mitteleuropa festhing. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge werden Extremwetterereignisse wie Überflutungen, aber auch Dürren durch den Klimawandel häufiger.