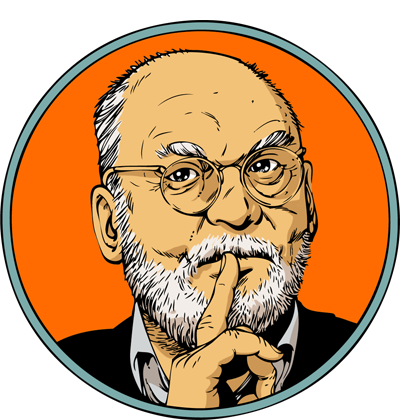© epd-bild/Frank Molter
Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm im Gespräch mit einem"Sea-Watch 4"-Mitarbeiter bei der Schiffstaufe im Februar 2020. Das Rettungsschiff soll voraussichtlich im August zu seinem ersten Einsatz im Mittelmeer auslaufen.
Bedford-Strohm sagte im Gespräch mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post", "es machen sich unvermindert Schlauchboote auf den Weg - entsprechend werden laufend Seenotfälle gemeldet, und es gibt Berichte über Bootsunglücke." Solange es die dringend erforderliche staatliche Seenotrettung weiterhin nicht gebe, "werden wir in der Unterstützung der privaten Seenotrettungsorganisationen nicht nachlassen", kündigte der bayerische Landesbischof an. Die Corona-Pandemie habe den Blick der Öffentlichkeit auf andere Fragen gelenkt. Deshalb sei es umso wichtiger, "dass wir nicht wegsehen, wenn Menschen ertrinken".
Das ehemalige Forschungsschiff war am 20. Februar in Kiel getauft worden. Finanziert wurde es vom Bündnis "United4Rescue", das maßgeblich von der EKD initiiert wurde. Sie hatte zu Spenden für das Schiff aufgerufen. Nach den ursprünglichen Plänen sollte das Schiff schon zu Ostern in See stechen. Dann machten aber die Einschränkungen wegen der Corona-Krise dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.
Die EU-Innenminister beraten am Dienstag unter anderem über die Seenotrettung im Mittelmeer. Vor der Konferenz der EU-Innenminister hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an seine Kollegen appelliert, in der Flüchtlingsfrage mehr Solidarität zu zeigen. "Wir müssen darauf hinwirken, dass alle Staaten in Europa Solidarität zeigen. Wir machen heute einen erneuten Versuch", sagte er am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Er fügte hinzu: "Aber das ist eine ganz, ganz harte Nuss. Die meisten Staaten haben sich bisher entzogen." Auch die EKD forderte die EU-Staaten auf, sich auf die Verteilung von Flüchtlingen zu einigen.
EKD: EU braucht endlich einen klaren Verteilmechanismus
Deutschland hat zum 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Die EU-Innenminister beraten zum ersten Mal unter Vorsitz von Seehofer. Der informelle Austausch findet wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz statt. Seehofer betonte vorab, Europa sei eine Wertegemeinschaft. Man müsse auf die vielen Schicksale und die humanitäre Verantwortung in Europa hinweisen. "Deshalb haben wir alle eine gemeinsame Verantwortung, den Staaten zu helfen und damit den Flüchtlingen, die Flüchtlinge zuerst aufnehmen. In dem Fall Italien und Griechenland", sagte Seehofer. Deutschland beteilige sich schon seit geraumer Zeit. Das ganze sei aber noch nicht so geordnet, dass man von einem geregelten Verfahren sprechen könne.
Bedford-Strohm sagte am Dienstag im RBB-Inforadio, er unterstütze ausdrücklich Seehofers Anliegen, dass mehr EU-Staaten Migranten aufnehmen, die aus Seenot gerettet wurden. Damit sollen vor allem Italien und Malta unterstützt werden, die von den Flüchtlingsschiffen zuerst angesteuert werden. Diese Länder dürften nicht alleingelassen werden, so Bedford-Strohm. Es brauche endlich einen klaren Verteilmechanismus, der regelt, wo die Menschen hinkönnen, fordert der bayerische Landesbischof: "Es kann nicht sein, dass jedes Mal wenn Menschen gerettet werden, das Geschachere losgeht und keine klaren Verteilwege da sind."
Bedford-Strohm betonte, viele Städte in Europa hätten sich bereiterklärt, Menschen aufzunehmen. Die nationalen Regierungen blockierten das aber. "Das muss endlich aufhören", forderte Bedford-Strohm.
Die Seenotrettung war zentrales Thema des EU-Innenministertreffens unter Vorsitz von Horst Seehofer (CSU) am Dienstag. Dabei ging es vorrangig nicht um die Seenotrettung selbst, sondern um die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten, die auf dem Mittelmeer gerettet wurden. Diese Seenotrettung betreiben derzeit vor allem private Organisationen von Schiffen wie der "Ocean Viking" und der "Sea-Watch 3" aus. Eine staatliche Mission von EU-Ländern, die Seenotrettung zum Ziel hat oder faktisch zahlreiche Menschen aus dem Mittelmeer rettet, gibt es derzeit nicht. Frühere Operationen wie "Mare Nostrum" und "Sophia" wurden eingestellt. Die Schiffe der aktuellen Mission "Irini", deren Hauptaufgabe die Durchsetzung eines Waffenembargos gegen Libyen ist, waren nach Auskunft einer Sprecherin bisher in keine Rettung eingebunden. Im September 2019 wurde auf Malta ein Mechanismus vereinbart, um Gerettete schneller anlanden und verteilen zu können. Daran beteiligen sich aber nur einige Länder. Immer wieder kommt es zu Verhandlungen und Wartezeiten, bevor die Menschen von Bord dürfen. Ihre reibungslosere Aufnahme ist dabei nur ein Teil der anstehenden Erneuerung des europäischen Asylsystems.