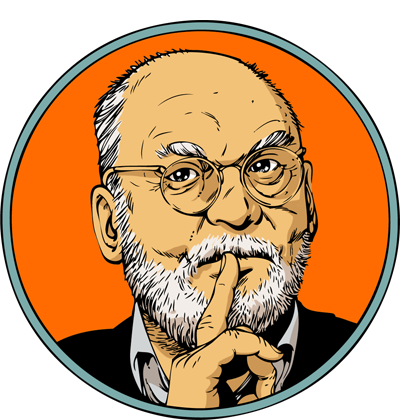© Getty Images/Kameleon007
Der neue Masterstudiengang will die persönlichere Betreuung von Trauernden und bessere Vorbereitung von Trauergesprächen und Beerdigungsgottesdiensten vermitteln.
An der Universität Regensburg kann man ab dem Wintersemester 2020/21 den Tod studieren. Die Theologische Fakultät hat ein Fach entwickelt, das in Deutschland einzigartig ist: "Perimortale Wissenschaften" nennt es sich und wird als Masterstudiengang angeboten: Er soll neue Wege im Umgang mit Sterben, Altern, Abschiednehmen aufzeigen.
Entwickelt wurde er von dem katholischen Theologen Rupert Scheule und Kollegen. Die Kirchen würden immer noch als "Kompetenzzentren für Sterben und Abschied, Tod und Trauer" wahrgenommen, sagt Scheule: "Wir haben einen großen weisheitlichen Schatz im Umgang mit diesen großen Fragen."
Den möchte er nutzen. Darum hat er sich für den interdisziplinär angelegten Masterstudiengang starkgemacht. "Perimortal" ist ein Kunstwort, das die Phase um den Tod herum bezeichnen soll. Etwa 30 Bachelorabsolventen können das Fach ab dem Wintersemester 2020/21 studieren, die Genehmigung der Universität dafür liege seit September vor, sagt Scheule. Denkbar wäre das beispielsweise für Absolventen der Pädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin und Theologie, aber auch für jede andere Fachrichtung.
In Deutschland sterben jedes Jahr 900.000 Menschen. "Sterben ist das große Zukunftsthema einer alternden Gesellschaft", sagt Scheule. "An der Uni wollen wir den gesamten Aktionsradius in den Blick nehmen", erklärt er. Und der beginnt für ihn "ab dem Zeitpunkt, in dem klarwird, dass ein Mensch sterben wird, und geht über seinen Tod hinaus".
"Sterben ist das große Zukunftsthema einer alternden Gesellschaft"
Als Diakon wird Rupert Scheule erst gerufen, wenn ein Mensch gestorben ist: Die Angehörigen wollen ein Trauergespräch, der Beerdigungsgottesdienst muss vorbereitet werden. "Ich wünsche mir, schon früher Kontakt zu den betroffenen Familien zu haben. Dann könnte ich die Menschen noch ganz anders begleiten."
In der "Schleuse zwischen Tod und Beerdigung" werde dann viel falsch gemacht, kritisiert Scheule. Beerdigungsinstitute neigten zur Routine. "Wenn die Mitarbeiter von Krematorien vor allen Dingen ihre Arbeit sehen und die Leichname nicht mehr wahrnehmen können als Symbole für ein ganzes Leben, das in diesem Körper verbracht wurde, läuft etwas schief." Die Menschen, die in der Totenversorgung arbeiten, ob im Krematorium oder im Bestattungsinstitut, bräuchten dringend mehr Unterstützung, auch seelsorgerliche.
"Ich kann niemandem sein Verhältnis zum Tod abnehmen"
Auch Geistliche benötigten eine professionelle Schulung im Umgang mit Tod und Sterben. Wenn ihnen "perimortale Kompetenz" abginge, neigten sie dazu, Sterbende und Trauernde "mit munteren Auferstehungsbotschaften zuzutexten". "Aber ich kann niemandem sein Verhältnis zum Tod abnehmen", sagt Scheule. Professionelle Distanzierungsverfahren und Selbstsorge in diesen Berufen seien wichtige Hilfen im Umgang mit dem Tod.
Die hohen Zeiten der Todesverdrängung scheinen nach seinem Empfinden allerdings vorbei zu sein. Gute Bestatter, Palliativmediziner und gute Hospize hätten das erkannt. Eine Umfrage unter jungen Studierenden hätte ergeben, dass sie "sehr interessiert" an dem Thema seien.
Sterben ist ein wichtiger Teil des Lebens
Sterben ist ein wichtiger Teil des Lebens, nicht der beste, "aber er gehört zum Leben dazu", sagt der evangelische Theologe Michael Fricke, der ebenfalls an der Entwicklung des Studiengangs mitgearbeitet hat. "Wer in Ruhe gehen will, sollte nicht erst am Ende auf sein Leben zurückblicken." Diese Erkenntnis hätten die Studierenden laut Umfrage gewonnen und seien auch deshalb offen für diesen Studiengang.
Ein Beratungsgespräch am Anfang soll die Eignung der Bewerber für den Masterstudiengang klären. Begonnen werde dann mit selbstreflexiven Seminaren, denen theologische Fragen folgten. In einem weiteren Modul soll eng mit der medizinischen Fakultät zusammengearbeitet werden: "Ein Arzt kann uns sagen, wie der Tod physiologisch abläuft."
Spiritualität für die ganze Gesellschaft
Auch rechtliche Fragen um Erbschaft und Friedhofsordnungen spielten in dem Studiengang eine Rolle. Eine Kulturgeschichte des Abschiednehmens schließe sich an. Der Studiengang umfasst vier Semester, in Teilzeit studiert, dauert er länger.
In New Jersey in den USA befassen sich Studentinnen und Studenten bereits seit 15 Jahren mit dem Tod, in einem Seminar für alle Fachrichtungen. Es beginnt mit einer Exkursion über den Friedhof und Aufgaben wie "finde einen Grabstein mit Bild", "finde wahre Liebe" - so beschreibt es Erika Hayasaki über die "Death Class" (Todesklasse) in ihrem gleichnamigen Buch.
Die Dozentin Norma Bowe geht, wie Hayasaki berichtet, mit ihrer Klasse auch zu einem Bestatter, in ein Hospiz, zu einer Obduktion. Es geht auch ums Sterben lernen. Die Autorin berichtet, dass nach dem Seminar viele der Mittzwanziger ihr Leben änderten. Sie trennten sich von ihren Partnern, wechselten ihr Studienfach. Oder riefen einfach nur ihre Eltern an. Sie täten, kurz gesagt, was vielen erst dann einfalle, wenn es zu spät sei.
Norma Bowes Studenten haben eine gute Chance, ihrem Tod ausgesöhnt zu begegnen. "Dann ist aus der Kunst des Sterbens eine Kunst des Lebens geworden", sagt der evangelische Theologe Fricke. "Das ist Spiritualität für die ganze Gesellschaft."
"Zwischen Tod und Beerdigung wird immer noch viel falsch gemacht" - Theologe Rupert Scheule über Begleitung um den Tod herum
Warum greift die Theologie das Thema Sterben, Tod und Trauer in einem Master-Studiengang auf?
Rupert Scheule: Sterben ist ein Zukunftsthema in einer alternden Gesellschaft. Für die Idee des Studiengangs steht das Kunstwort "Perimortal", also "um den Tod herum". In den evangelischen wie katholischen Theologien haben wir einen großen weisheitlichen Schatz im Umgang mit den großen Fragen, einschließlich der Frage nach dem Tod. Wir nehmen in dem Studiengang systematisch diese Phase um den Tod herum in den Blick. Sie beginnt da, wo klar wird, ein Mensch wird bald sterben, und geht über dessen Tod hinaus. In dieser Schleusenzeit zwischen Tod und Beerdigung, da wird immer noch viel falsch gemacht.
Was läuft da falsch?
Scheule: Wenn Sie beruflich mit dem Tod zu tun haben, ist es schwer, einer Routinisierung zu entkommen. Das hat nichts mit Kaltherzigkeit zu tun, sondern mit Selbstschutz. Trotzdem ist es fatal, wenn bei Betroffenen ankommt, sie sind nur Gegenstand professioneller Routinen. Es ist nicht zuletzt ein Ziel des Studiengangs, den Profis Möglichkeiten einer Self Care bereitzustellen, damit sie Menschen authentisch nahe sein können, ohne dabei selbst vor die Hunde zu gehen. Die Leute, die in der Totenversorgung arbeiten, ob im Krematorium oder im Bestattungsinstitut, bräuchten dringend mehr Unterstützung, auch seelsorgerliche.
Wie kann ein "perimortaler Begleiter" die Trauernden unterstützen?
Scheule: Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich glaube nicht, dass gläubige Menschen ein Ticket für eine entspanntere Todesstunde haben, nur weil sie gläubig sind. Ich bezweifle auch, dass wir, wenn wir als Seelsorger oder Seelsorgerin an Trauernde herangehen, gleich mit unseren Hoffnungsbotschaften kommen müssen. Jesus legt in der Emmausgeschichte auch keine Auferstehungsshow vor den trauernden Jüngern hin, sondern er geht erst einmal schweigend mit ihnen mit und hört ihnen zu. Das ist nicht nichts, das ist Solidarität. Der Weg nach Emmaus ist ein gutes Bild dafür, wie perimortale Begleiter sein sollten.
Können Sie verstehen, dass der Mensch den Tod verdrängen möchte?
Scheule: Ich glaube, der Tod ist eine Riesenkränkung. Allein der Umstand, dass uns nichts so sicher ist wie der Tod, wir aber keine Ahnung haben, was da auf uns zukommt, weil bisher ja immer nur die anderen gestorben sind, bringt uns Kontrollfreaks in Rage. Es ist also nicht unplausibel, immer wieder weg zu wollen vom Todesthema. Praktisch heißt das oft, dass die tote Oma zügig unter die Erde muss, damit die - nur vorläufig noch nicht toten - Angehörigen schnell wieder in ihr sogenanntes normales Leben zurückkehren können. Aber das ist vielleicht nicht mehr die einzige Option, die Menschen heute sehen. Ich glaube, dass die hohen Zeiten der Todesverdrängung vorbei sind. Wir merken das auch daran, dass junge Menschen an unserem Studiengang interessiert sind, wie wir bei einer Umfrage herausgefunden haben. Die Erkenntnis wächst: Sterben und Trauern sind vor allem eines: ziemlich intensives Leben.