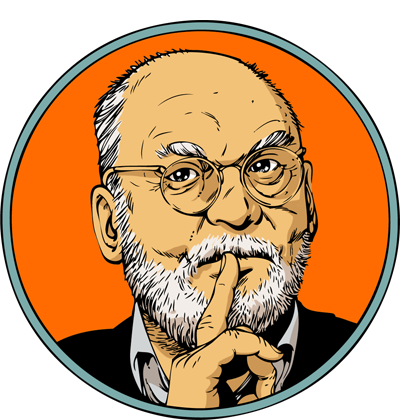© Getty Images/iStockphoto/luctra_design
Die bayerische Landessynode befasst sich ab Sonntag mit dem Thema "Frieden".
Beim Thema Frieden, über das die evangelische bayerische Landessynode ab Sonntag (24. März) in Lindau am Bodensee diskutiert, gibt es unter den bundesweiten Kirchen bereits einen Vorreiter: die evangelische Landeskirche in Baden. Ein Arbeitskreis im Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald hat einst den Prozess angestoßen, der die badische evangelische Landeskirche bis heute grundlegend verändert: Sie ist bundesweit die einzige Institution, die versucht, eine "Kirche des gerechten Friedens" zu sein.
2011 schrieb der lokale Arbeitskreis "Frieden" eine Eingabe an die Landessynode Baden. Darin forderte er, man solle die friedensethische Position der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) überdenken und in einer breiten Diskussion eine neue Friedenstheologie erarbeiten. In der Folge entwarf eine Arbeitsgruppe das Positionspapier "Neuorientierung Friedensethik". Dieses wurde in allen Kirchenbezirken und -gemeinden diskutiert. 2013 organisierte die Landeskirche einen Studientag zum friedensethischen Prozess. Kurz danach beschloss die Landessynode das Diskussionspapier "Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens (Lk 1,79) - ein Diskussionsbeitrag aus der Evangelischen Landeskirche in Baden".
Konfliktfreie Kommunikation und Friedenspädagogik
2018 erschien das Papier "Sicherheit neu denken", das in verschiedenen Szenarien den Weg der militärischen Sicherheitspolitik hin zu zivilen Lösungen skizziert. Darin werden fünf Punkte einer zivilen Sicherheitspolitik und die Veränderungen beschrieben hin zu einem Punkt, an dem militärische Problemlösung unnötig wird. Es werden ökologisch, wirtschaftlich und sozial gerechte Außenbeziehungen der EU gefordert sowie eine nachhaltige Entwicklung der EU-Anrainerstaaten in Nordafrika, dem Nahen Osten und Osteuropa. Man strebt eine internationale Sicherheitsarchitektur an, in der Krisen zivil gelöst werden.
So soll Deutschland im Jahr 2040 durch die Beteiligung von 50.000 zivilen Fachkräften Konfliktlösungen der UNO-Friedensmissionen stärken. Einer der Pläne ist, alle Bevölkerungsschichten in konfliktfreier Kommunikation und Friedenspädagogik auszubilden. Vorbild ist das Modell des Zivilen Peacekeepings, das Menschen ohne den Einsatz von Gewalt schützt. Der letzte Punkt betrifft die Umwandlung (Konversion) der Bundeswehr sowie der Rüstungsindustrie in ein rein zivil agierendes (Internationales) Technisches Hilfswerk.
Die Verfasser des Szenarien-Papiers führen eine Studie der US-amerikanischen Wissenschaftler Erica Chenoweth und Maria J. Stephan aus dem Jahr 2011 an, nach der gewaltfreie Kampagnen eine doppelt so hohe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen wie militärische Interventionen. Militäreinsätze lösen häufig eine Spirale der Gewalt und Gegengewalt aus, die die Situation sogar oft noch verschlechtert. Die (Bürger-)Kriege in Afghanistan, dem Irak und Syrien scheinen diese Ergebnisse zu bestätigen.
Forderungen des Papiers der badischen Landeskirche an die Politik sind daher eine gerechte Wirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass es Ungleichheiten zwischen Ländern und Kontinenten nicht mehr gibt. Notwendig sei jedoch eine massive finanzielle Umverteilung. So betrugen die Ausgaben der Bundesregierung im Zeitraum von 2010 bis 2013 für den Zivilen Friedensdienst (ZFD) 0,04 Milliarden Euro, für die Bundeswehr hingegen 33 Milliarden.
Hans-Jürgen Krauß, Geschäftsführer des Nürnberger Evangelischen Forums für den Frieden (NEFF), schloss sich gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd) den Forderungen der badischen Landeskirche an. Er wünschte sich den Beginn einer solchen Diskussion mit der Tagung der Landessynode im März in Lindau auch in Bayern. "Die Münchner Sicherheitskonferenz hat gezeigt, dass es heute so viele militärische Konflikte gibt wie noch nie", sagte er. Ein Umdenken sei dringend nötig.
Bei der Landessynode sei der Zeitpunkt, dass man auch in Bayern flächendeckend diskutiert, wie ein "Frieden schaffen ohne Waffen" umsetzbar sei. Die Kirche müsse Frieden als eine weltlich zu schaffende Aufgabe sehen und die vielen Basisgruppen, die sich im kirchlichen Bereich für Frieden einsetzten, mit ins Boot holen. "Aufrüstung und militärische Drohungen sind die Gefahr für unsere Gesellschaft, nicht die Lösung", stellt Krauß fest.
Ziviles Peacekeeping
Als Argument gegen militärische Interventionen wird bei Diskussionen oft die Möglichkeit von Zivilem Peacekeeping (ZPK) angeführt. ZPK ist die aktive Präsenz von unbewaffneten Zivilisten in Krisenregionen, um die Bevölkerung vor Gewalt zu schützen. Der Ursprung liegt im gewaltfreien Widerstand Mahatma Gandhis während des Indischen Unabhängigkeitskampfes. Zivile Friedensstifter bauen eine vertrauensvolle Beziehung zu den Menschen vor Ort auf, um Gewalt vorzubeugen, die Konfliktparteien zusammenzubringen und der Gewalteskalation zu widerstehen. Sie schaffen sichere Orte, wo die Gemeinschaft Konflikte durch Dialog löst, überwachen Waffenstillstände und Wahlen. Sie sind unparteiisch und unabhängig von politischen Akteuren, wie unter anderem der Bund für Soziale Verteinigung erklärt.
Die Nichtregierungsorganisation Nonviolent Peaceforce (NP) ist unter anderem in Kolumbien und im Südsudan aktiv. In Kolumbien tobte zwischen 1966 und 2016 ein Konflikt zwischen der Rebellengruppe FARC und der Regierung sowie paramilitärischen Todesschwadronen. Dabei wurden mehr als 260.000 Menschen getötet. Durch Begleitung durch NP-Personal werden Menschenrechtsaktivisten vor Anschlägen beider Seiten geschützt. Im Südsudan sind etwa 150 NP-Mitarbeitende vor Ort. Dort begleiten sie friedliche Konfliktlösungen zwischen ethnischen Gruppen.
Der finanzielle Fokus der Bundesregierung liegt weiterhin auf militärischen Lösungen. 2017 gab sie 37 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus, für den Zivilen Friedensdienst (ZFD) nur 40 Millionen Euro. Ein Peacekeeper kostet im Jahr weniger als 50.000 Euro, ein deutscher Soldat im Auslandseinsatz zwei Millionen Euro, schätzen Friedensforscher.