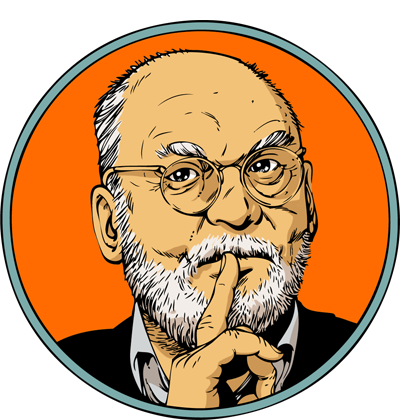Foto: epd-bild/Internationales Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) Dortmund
Erich Klibansky wurde 1942 mit mehr als 1.000 anderen Kölner Juden in das Vernichtungslager Maly Trostenez deportiert und ermordet. Eine Tafel in einer Wanderausstellung erinnert an sein Schicksal.
Das NS-Vernichtungslager Maly Trostenez in Minsk ist ein in Deutschland weitgehend unbekannter Schauplatz des Holocaust. Dabei wurden auch Juden aus deutschen Städten dorthin deportiert und ermordet. Am 29. Juni wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der weißrussischen Hauptstadt eine Gedenkstätte eröffnen. Dann wird auch einer der wenigen noch lebenden Nachfahren der Opfer mit dabei sein: Der 92-jährige Kurt Marx konnte in einem Kindertransport von Köln nach London entkommen, seine Eltern wurden in Maly Trostenez ermordet.
Juden aus Hamburg, Köln, Düsseldorf, Bremen, Frankfurt am Main, Berlin und Prag wurden ab 1941 in Zügen nach Minsk gebracht unter dem Vorwand, sie in den von der deutschen Wehrmacht eroberten Gebieten in der Sowjetunion anzusiedeln. Darunter war auch die 61-jährige Ärztin Hedwig Jung-Danielewicz, die am 11. November 1941 mit 995 anderen Juden aus Düsseldorf und Umgebung an der Sammelstelle am Schlachthof eintraf.
Schon zu Schulzeiten hatte die Jüdin antisemitische Schikane erlebt. Dennoch machte sie Abitur, studierte als eine der ersten deutschen Frauen Medizin und eröffnet 1911 in der Düsseldorfer Innenstadt als erste Ärztin eine Praxis für Frauen- und Kinderheilkunde. Sie heiratete den Maler Karl Jung-Dörfler, der aber schon nach wenigen Jahren starb. Als "Hedwig Sara Jung, geborene Danielewicz, Beruf unbekannt", wurde sie auf der Deportationsliste geführt. Per Zug ging es nach Minsk, damals Hauptstadt der Sowjetrepublik Weißrussland.
Die Wehrmacht hatte die Sowjetunion am 22. Juni 1941 überfallen und die westliche Sowjetrepublik in wenigen Wochen eingenommen. In Minsk richtete die SS auf Befehl des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin sofort ein jüdisches Ghetto ein. 80.000 Menschen lebten auf engstem Raum in den Holzhäusern der Altstadt. Als die Transporte mit den deportierten Menschen ankamen, wurden im Ghetto Bewohner umgebracht, um Platz für die Neuankömmlinge zu schaffen. Im Vorort Maly Trostenez richteten die deutschen Besatzer einen Erschießungsplatz ein und hoben Massengräber aus.
Der Düsseldorfer Transport nach Minsk war einer der ersten. Aus Hamburg waren wenige Tage zuvor auch 1.000 Juden angekommen. Als Hedwig Jung-Danielewicz eintraf, half sie im Ghetto anderen Menschen, so gut sie konnte. Ein Soldat, der sie kannte, stahl für sie Medikamente und Verbandszeug aus der Wehrmachtsapotheke.
In Köln sorgte unterdessen der Direktor der einzigen weiterführenden jüdischen Schule im Rheinland, Erich Klibansky, dafür, dass 140 seiner Schüler in Kindertransporten nach England entkamen, unter ihnen auch Kurt Marx. Er hatte sich leicht von seinen Eltern verabschiedet. "Wir sehen uns in Amerika!" flüsterten sie einander noch auf dem Bahnhof zu.
Erich Klibansky leitete die Jawne-Schule und hatte rechtzeitig erkannt, dass Juden unter den Nationalsozialisten keine Zukunft hatten. Er plante, seine Schule ganz nach England zu verlegen - aber nicht rechtzeitig. Am 20. Juli 1942 wurde auch aus Köln ein Transport mit 1.164 jüdischen Kindern, Frauen und Männern nach Minsk geschickt. Die Eltern von Kurt Marx waren dabei und sein Schulrektor Erich Klibansky. Sie wurden, wie heute bekannt ist, nicht mehr in das Minsker Ghetto gebracht, sondern unmittelbar nach der Ankunft in Maly Trostenez ermordet. Dort starb vermutlich auch die Ärztin Hedwig Jung-Danielewicz. Ihre Spur verliert sich und sie wurde nach dem Krieg für tot erklärt.
Auf den von der nationalsozialistischen Verwaltung geführten Listen sind etwa 60.000 Menschen verzeichnet, die in Maly Trostenez erschossen oder in Gaswagen getötet wurden. "Holocaust mit Kugeln" nennt das der Direktor des Berliner Denkmals für die ermordeten Juden Europas, der Historiker Uwe Neumärker. Die Leichen wurden, als die Wehrmacht auf dem Rückzug war, 1943 wieder aus den Massengräbern gezerrt, auf letztes Zahngold untersucht und dann verbrannt.
"Die Menge der Asche allein zeigt uns, dass mindestens 200.000 Menschen hier getötet wurden," sagt der orthodoxe Erzpriester von Minsk, Fjodor Powny. "Die genaue Zahl der Opfer werden wir nie kennen", ergänzt Neumärker, "aber jeder Einzelne ist einer zuviel."
Maly Trostenez war der größte Vernichtungsort in Weißrussland während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Dort wurden unter deutschem Befehl mindestens 60.000 Menschen ermordet, meist Juden. Sie waren aus Hamburg, Köln, Düsseldorf, Bremen, Frankfurt Berlin, Wien und Prag in Zügen mit jeweils 1.000 Menschen zwischen 1941 und 1942 nach Minsk deportiert worden.
Die Massenerschießungen in Maly Trostenez, das heute auf dem Stadtgebiet von Minsk liegt, begannen im Frühjahr 1942. In 34 Massengräbern wurden die Leichen zunächst verscharrt. Damit wurde Maly Trostenez zu einem der Hauptschauplätze des "Holocaust mit Kugeln". "Vom Baby bis zum Greis wurden die Leute erbarmungslos erschossen. Manchmal hat man bei Babys noch die Kugeln gespart und sie lebendig in die Grube geworfen," sagt der Historiker und Direktor des Berliner Denkmals für die ermordeten Juden, Uwe Neumärker.
Als die sowjetische Rote Armee nach ihrem Sieg in der Schlacht von Stalingrad 1943 auf dem Vormarsch war, ordnete die deutsche Führung an, die Gräber auszuheben, die Toten auf letzte Wertsachen, etwa Zahngold, zu untersuchen und die Leichen zu verbrennen. Russische Gefangene, die dazu abkommandiert waren, wurden nach dieser sogenannten "Aktion 1005" ebenfalls erschossen.
Über die Zahl der Opfer sind deutsche und weißrussische Historiker uneins. Deutsche halten aufgrund der Deportationslisten etwa 60.000 Tote für belegt, weißrussische gehen von mindestens 200.000 Toten aus. "Allein die Menge der Asche belegt, dass es so viele sein müssen", sagt der orthodoxe Erzpriester von Minsk, Fjodor Powny.
Die deutsch-weißrussische Organisation Internationales Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) aus Dortmund setzt sich seit der Perestroika für Verständigung mit Weißrussland ein und hat nach Bekanntwerden der Verbrechen von Maly Trostenez den Bau einer Gedenkstätte angeregt. 2016 unterzeichneten das IBB und die Stadt Minsk eine Vereinbarung zur Errichtung des Mahnmals. Am 29. Juni wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier es nun einweihen. An der Finanzierung der Gedenkstätte haben sich auch das Auswärtige Amt, die Bethe-Stiftung und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sowie private Spender, Kirchen und Kommunen aus Deutschland beteiligt.