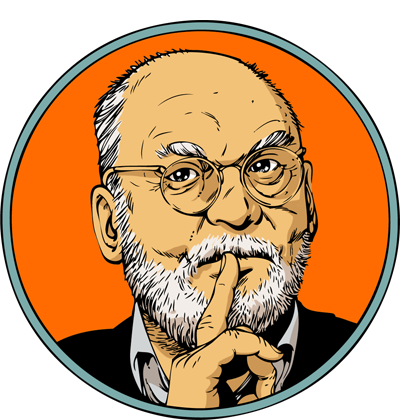Foto: epd-bild/Heike Lyding
Die Iranerin Vajiheh Shapouri erzählt bewegt in ihrer Wohnung im Rhein-Neckar-Kreis von ihrem Leben im Kirchenasyl.
Manchmal liegt die Rettung in einer Art Gefangenschaft. Idyllisch liegt das Ketscher Pfarrhaus da, unter seinem Walmdach aus roten Ziegeln und den grün gestrichenen Fensterläden. Dahinter windet sich der Altrhein. Gerne hätte Vajiheh Shapouri, damals Anfang dreißig, mit ihrer kleinen Tochter einen Spaziergang am Ufer gemacht. Daran war nicht zu denken. Die Iranerin hätte nicht einmal gewagt, einen Fuß auf die Straße zu setzen, um von dort aus einen Blick auf ihre neue Bleibe zu werfen.
Heute, drei Jahre später, ist sie in Sicherheit. Aber in den sieben Monaten, in denen sie mit Mann und Tochter Kirchenasyl im Dachgeschoss des Pfarrhauses fand, verließ Shapouri das Grundstück nicht - mit einer Ausnahme. "Ein Mal war ich draußen", sagt sie auf Deutsch, dabei klingt sie energisch. Damals hatte sie Zahnschmerzen, Pfarrer Walter Sauer brachte sie zum Arzt.
Eine Art Gefangenschaft
Mit so viel Aufregung am Ende seines Berufslebens hatte Pfarrer Sauer nicht gerechnet. Der Ruhestand war zum Greifen nahe, als sich der Anwalt der dreiköpfigen Familie an ihn wandte: ob er bereit sei, ihr Kirchenasyl zu gewähren? Schließlich hatte er die Familie ein paar Monate zuvor, am ersten Advent 2013, katholisch getauft. Mit Kirchenasyl hatte sich Pfarrer Sauer bis dahin nie beschäftigt, dennoch gab es für ihn nicht viel zu überlegen. "Ich kann sie ja nicht taufen und dann sagen, ihr Schicksal ist mir egal", erinnert er sich. Darin stimmte ihm auch der Pfarrgemeinderat zu.
Immer wieder bieten Kirchen in Deutschland Flüchtlingen Schutz. Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche weiß von 348 Fällen mit mindestens 531 Flüchtlingen, die derzeit in der Obhut von Kirchen sind. In der Politik sorgt das Kirchenasyl für Diskussionen. Vor allem, weil es in rund 90 Prozent der Fälle das geltende Recht umgeht, wonach eigentlich ein anderes EU-Land für die Flüchtlinge zuständig wäre.
So war es auch bei Shapouris Familie. Ihr drohte die Ausweisung nach Italien. Ein Schleuser hatte ihnen ein Flugticket von Teheran nach Frankfurt am Main besorgt, dazu ein Visum für Italien. Fragen zu den Formalitäten hätten sie nicht gestellt, sagt Shapouri. Die deutschen Behörden erklärten, sie seien für die Familie nicht zuständig, und ihre Tage in einer Heidelberger Flüchtlingsunterkunft schienen gezählt. Wie es in Italien weitergehen würde, war ungewiss. "Dort hätte man ihren Asylantrag ablehnen und sie in den Iran zurückschicken können", sagt Sauer. "Und wer weiß, wie es ihnen dort ergangen wäre."
Der Grund für seine Sorgen: Die Shapouris sind Christen, wurden aber als Schiiten geboren. Christen im Iran genießen zwar gewisse Rechte. Aber wer dem Islam den Rücken kehrt, bringt sich in Gefahr. Diskriminierung im täglichen Leben ist für Muslime, die zum Christentum konvertieren, noch das geringste Übel. Zu Razzien, Festnahmen und Verurteilungen kommt es laut Amnesty International immer wieder.
Auch Shapouri bekam es im Iran schon mit der Polizei zu tun - zumindest beinahe, wie sie sagt. In ihrem Frisörsalon im Teheraner Stadtteil Gisha habe sie eine Christin kennengelernt. Sie mochte die Frau, die ihr von Jesus erzählte. Shapouris Interesse war geweckt. Sie traf sich mit anderen, um gemeinsam in der Bibel zu lesen. Jede Woche, berichtet sie, saßen sie in einer anderen Wohnung zusammen. Was ihr gefiel, lässt sich wohl als Barmherzigkeit Gottes bezeichnen. "In der Moschee sagen sie: Tod Amerika. Tod Israel. Aber Jesus war gut, er sprach von Liebe." Shapouri wollte frei über ihren Glauben entscheiden. An ein Leben außer Landes, beteuert sie, habe sie damals nicht gedacht.
Zerreißprobe ist noch nicht ganz ausgestanden
Eines Tages, die Familie war außer Haus, habe ihre Mutter sie angerufen: Die Polizei durchsuche gerade ihre Wohnung. Hals über Kopf hätten sie sich zur Flucht entschlossen, sagt Shapouri. Bis zur Abreise seien sie bei Bekannten untergetaucht. Es gab kein Zurück. Das Kirchenasyl bewahrte sie und ihre Familie davor, aus Deutschland ausgewiesen zu werden. Keine Frage, die Zeit damals zerrte an ihren Nerven. Wenn sie am Fenster des Pfarrhauses stand und einen Helikopter am Himmel sah, dachte sie, man suche nach ihnen.
Christen im Iran: Schätzungen zufolge leben im Iran 200.000 bis 300.000 Christen, möglicherweise sind es jedoch mehr. Die Schia, eine der beiden Hauptströmungen des Islams, ist im Iran Staatsreligion. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ist muslimisch. Anderen Religionen hängen insgesamt nur rund 0,3 Prozent der Bevölkerung an. Christen, Juden und Zoroastrier - Anhänger einer alten persischen Religion - erkennt die iranische Verfassung offiziell als religiöse Minderheiten an. Artikel 13 garantiert ihnen, ihren Glauben im Rahmen der iranischen Gesetze frei praktizieren zu können. Religionsfreiheit herrscht im Iran jedoch nicht. Minderheitenreligionen dürfen nicht missionieren, Muslime die Religion nicht wechseln. Richter können den Glaubenswechsel mit dem Tod bestrafen. In der Praxis werden immer wieder lange Haftstrafen gegen friedliche Christen verhängt. Insbesondere Konvertiten müssen mit Festnahmen und Razzien rechnen. Im Alltag werden Christen ebenso wie Mitglieder anderer Minderheitenreligionen im Bildungswesen, bei Erbschaftsangelegenheiten und auf dem Arbeitsmarkt häufig benachteiligt - in Abhängigkeit von der Region, mitunter von dem Stadtteil oder auch dem Milieu, in dem sie sich bewegen.
Konvertiten im Asylverfahren: Wenn Flüchtlingen aufgrund ihres Glaubenswechsels im Heimatland Verfolgung droht, wird ihnen in Deutschland grundsätzlich Schutz gewährt. Bedingung ist, dass Asylbewerber ihren Übertritt von einer Religion zur anderen überzeugend darlegen können. Zahlen dazu, wie oft ein Glaubenswechsel zu einem erfolgreichen Asylverfahren führt, gibt es nicht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erfasst die Gründe, die Asylsuchende vortragen, statistisch nicht. Das erklärt die Behörde damit, dass die Begründungen der Antragsteller so vielschichtig seien, dass sie sich nicht auf eine Komponente reduzieren ließen. Ebenso wenig erstellt das Bundesamt Statistiken dazu, warum ein Asylantrag abgelehnt oder anerkannt wird. Im Asylverfahren muss der Sachbearbeiter beurteilen, ob asyltaktische Gründe oder echte Überzeugungen hinter dem Glaubenswechsel stehen. Nach Möglichkeit sollen Flüchtlinge ihre Konversion beweisen - zum Beispiel mit einer Taufbescheinigung. Weil solch ein Nachweis allein jedoch nichts darüber aussagt, wie der Antragsteller seinen Glauben nach der Rückkehr in seine Heimat praktizieren will und mit welchen Risiken dies einhergeht, sind diese Fragen bei Konvertiten immer Teil der persönlichen Anhörung. Das Bundesamt stellt seinen Sachbearbeitern aktuelle Informationen über die Herkunftsländer zur Verfügung. So sollen sie ermessen können, ob Antragstellern bei Rückkehr in die Heimat Verfolgung aufgrund von Glaubensfragen droht.